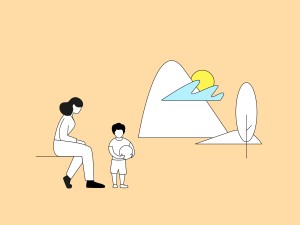Viele Mütter stellen hohe Anforderungen an sich selbst. Deutlich höhere, als Väter es tatsächlich von ihnen erwarten. Das zeigt die neue Studie „Familie und Erziehung 2025“ der Pronova BKK. Familienpsychologin Nina Grimm erklärt, wie es zu diesem Missverhältnis kommt, welche alten Prägungen es widerspiegelt und was es braucht, um ein partnerschaftliches Familienmodell zu leben.
Pronova BKK: Mütter haben höhere Ansprüche an sich selbst, als Väter es tatsächlich von ihnen erwarten. Was bedeutet diese Diskrepanz und wie können Mütter lernen, mehr Verantwortung abzugeben?
Nina Grimm: Die Erwartungen der Mütter an die Beziehung zu ihrem Kind sind nur sehr bedingt davon geprägt, was der Vater erwartet. Vielmehr spiegeln sie überhöhte bis verzerrte Ansprüche wider, die Mütter an sich selbst stellen. Diese sind meist tief in der Persönlichkeitsstruktur verankert und basieren auf verinnerlichten Glaubensätzen wie „Ich darf keine Fehler machen“ oder „Ich muss perfekt sein“, die aus der eigenen Erziehung und frühen Sozialisation resultieren. Gesellschaftliche Rollenbilder und implizite Erwartungen wirken zusätzlich verstärkend.
Pronova BKK: Was hilft, diese Muster zu durchbrechen?
Grimm: Zunächst einmal ist es wichtig, sich die dahinterliegenden Ängste bewusst zu machen. Was hindert mich daran, auch mal Fünfe gerade sein zu lassen und Aufgaben abzugeben? Bei der einen Person ist es das Bedürfnis nach Kontrolle, da sie ihren Selbstwert stark aus der perfekten Erziehung zieht. Bei der anderen steckt vielleicht die Sorge dahinter, dass das Kind Schaden nehmen könnte. Oft verbirgt sich dahinter ein biografischer Schmerz, selbst zu kurz gekommen zu sein, verbunden mit der Absicht, diesen Fehler bei dem eigenen Kind nicht wiederholen zu wollen. Das Problem dabei ist: die an und für sich gute Intention basiert auf einem alten Schmerz. Das macht den Alltag und den Umgang damit für so viele Mütter unnötig schwer.
Pronova BKK: Was raten Sie?
Grimm: Diese Ängste lassen sich nicht einfach wegargumentieren. Es braucht individuelle Strategien und die Bereitschaft, sich mit der eigenen Biografie auseinanderzusetzen. Wer es schafft, die eigenen Antreiber zu erkennen und zu relativieren, kann selbstbewusster handeln und Verantwortung teilen.
Pronova BKK: Und was können Väter konkret tun, um diesen Prozess zu unterstützen?
Grimm: Ganz simpel. Lasst euch beeinflussen! Anerkennt die Tatsache, dass eure Partnerin mitunter geübter ist und Dinge berücksichtigt, die euch gar nicht bewusst sind. Nehmt das weder als persönlichen Angriff noch als implizite Information, dass sie euch nichts zutraut und ihr es eh nicht recht machen könnt. Schiebt diesen emotionalen Film beiseite und hört ihr zu! Das bedeutet nicht, dass ihr euren eigenen Stil aufgeben müsst. Es geht um ein Zusammenspiel. Sich offen zeigen für Hinweise, aber gleichzeitig auch den eigenen Weg finden dürfen. Diese Balance ist entscheidend.
Pronova BKK: Viele Väter formulieren hohe Ansprüche an ihre Rolle. Sie wünschen sich emotionale Nähe, Präsenz und Verantwortung. In der Umsetzung sieht es dann aber oft anders aus. Woran liegt das?
Grimm: Viele Väter wissen, dass diese Werte gesellschaftlich anerkannt sind, und sie wollen gute Väter sein. Im Alltag handeln sie meist pragmatisch, rational und zielführend. Sie konzentrieren sich auf die wirklich notwendigen Dinge und achten dabei weniger auf emotionale und soziale Details. Wenn das Klettergerüst aufgebaut ist, betrachten sie ihre Aufgabe als erfüllt und widmen sich dann den Fußballergebnissen auf dem Handy. Dass die Begleitung des Kindes auf dem Klettergerüst ein weiterer Teil des Jobs ist, rückt dann für viele in den Hintergrund. Hinzu kommt, dass es Männern oft leichter fällt, sich selbst und den eigenen Weg ohne schlechtes Gewissen zu priorisieren.
Pronova BKK: Und was ist mit den Müttern. Wie setzen sie die Werte im Alltag um?
Grimm: In diesem Beispiel würde für viele Mütter Verantwortung nicht mit dem Aufbau des Klettergerüsts beginnen, sondern mit der achtsamen Begleitung des Spiels. Präsent sein, dem Kind zuschauen und es emotional auffangen. Sie leben Nähe nicht über das Ergebnis, sondern über den Austausch. Genau darin liegt der Unterschied. Beide Seiten wollen dasselbe. Für ihr Kind da sein. Doch was das konkret bedeutet, interpretieren sie unterschiedlich. Daraus entstehen im Alltag Missverständnisse und ein gefühlter Gap zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Dabei geht es oft weniger um mangelnden Willen als um verschiedene Perspektiven auf eine Situation.
Pronova BKK: Studien zeigen auch, dass Väter die Leistungen ihrer Partnerinnen im Alltag seltener wahrnehmen. Warum ist das so?
Grimm: Oft fehlt tatsächlich schlicht die Erfahrung. Viele wissen nicht, was es bedeutet, einen Familienalltag zu managen, Kinder zu versorgen und sie emotional zu begleiten. Genau diese emotionale und mentale Arbeit ist unsichtbar. Es ist schwer zu vermitteln, was es heißt, 24/7 präsent zu sein, nicht einfach auf die Toilette gehen zu können oder wie sehr simple Aufgaben wie Nudeln kochen durch 17 Unterbrechungen erschwert werden. Die sogenannte „Care-Taker-Belastung“ ist nur für diejenigen nachvollziehbar, die sie selbst durchlebt haben. Und das nicht nur für ein paar Stunden am Wochenende, sondern Tag und Nacht über mehrere Monate hinweg. Hinzu kommt, dass Männer und Frauen unterschiedlich mit emotionalem Stress umgehen.
Pronova BKK: Bitte geben Sie ein Beispiel.
Grimm: Männer suchen bei Stress oft nach praktischen Lösungen. Wenn das Baby weint, während die Nudeln kochen, lautet die Antwort häufig: „Dann lass es doch einfach kurz weinen.“ Frauen sind in ihrer Problemlösung dagegen sozial und emotional orientiert. Es soll allen gut gehen und jede*r soll gesehen werden. Das bringt andere, gerade im Familienalltag sehr viel facettenreichere Aufgaben und Perspektiven mit sich, die Männer häufig weniger berücksichtigen. Das heißt aber nicht, dass Männer dieser Aspekte nicht wertschätzen können. Hierfür braucht es ein offenes Gespräch, in dem beide Seiten einander wirklich zuhören, ohne gleich zu bewerten.
Pronova BKK: In der Studie fällt auf, dass beim Rollenbild überraschend große Einigkeit herrscht. Viele Eltern sehen die Mutter für die emotionale Begleitung und den Vater für finanzielle Sicherheit zuständig. Woran liegt das?
Grimm: Ein Grund ist sicher die frühe Bindung zwischen Mutter und Kind durch die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Das ist sicherlich einer der begünstigenden Faktoren für das klassische Rollenbild, das viele Kleinfamilien mehr oder weniger bewusst für sich wählen. Aber auch strukturelle Aspekte spielen eine Rolle. Mütter steigen oft automatisch aus dem Beruf aus, verdienen oft weniger. Teils aufgrund der Berufswahl, teils wegen des Gender Pay Gaps. So entscheiden sich viele Kleinfamilien einfach aus finanziellen Gründen für die klassische Rollenverteilung. Nicht zuletzt auch aus pragmatisch-emotionalen Gründen, da eine Frau nach einer Geburt ja auch tatsächlich körperlich und emotional schutzbedürftig ist. Hier können Männer mit ihren Kompetenzen einfach gut glänzen und auf der pragmatischen Ebene ihre Familie versorgen.